


|

|
|
|
Die monatliche GNU-KolumneBrave GNU WorldGeorg C.F. Greve |
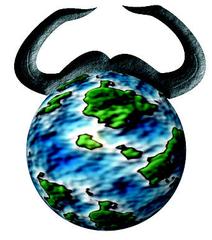
|
Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Brave GNU World, die wieder zum Teil den UNO-Gipfel zur Informationsgesellschaft (WSIS) behandelt. Da der Gipfel Rahmenbedingungen auf Jahre bis Jahrzehnte hinaus definieren soll, ist es angebracht, ihn mehrmals zu erwähnen und die intensive Vorbereitung zu dokumentieren. Um die technische Seite aber nicht zu vernachlässigen, sind als Einstieg zunächst zwei Projekte dran.
Der Hinweis auf das Programm namens Jaxodraw kam von Thomas Theußl per E-Mail an die übliche Adresse unter[1]. Jaxodraw[5] ist ein Programm, mit dem Anwender interaktiv Feynman-Diagramme erstellen.

Richard Feynman war einer der einflussreichsten Physiker des 20. Jahrhunderts.
Für seine Arbeit auf dem Gebiet der Quantenelektrodynamik erhielt er 1965 den Nobelpreis gemeinsam mit Sin-Itiro Tomonaga und Julian Schwinger. Seine "Feynman Lectures on Physics" sind für viele Physikstudenten die erste (und auch beste) Lektüre. Feynman-Diagramme sind Ort-Zeit-Diagramme, die die Wechselwirkung von Elementarteilchen im Raum darstellen. Die x-Achse repräsentiert dabei den Ort und die y-Achse die Zeit.

Jaxodraw bietet eine grafische Wysiwyg-Oberfläche, dazu bedient es sich des Axodraw-Pakets[6] von J.A.M. Vermaseren. Der Benutzer erstellt so seine Feynman-Diagramme mit der Maus und kann sie nach Bedarf mit der Tastatur detailliert verfeinern. Als Dateiformat für Jaxodraw-Diagramme dient XML und für die Ausgabe hat der Benutzer die Wahl zwischen (Encapsulated) Postscript und Latex-Code.
Speziell die Ausgabe im Latex-Format war eine wesentliche Motivation für die Jaxodraw-Autoren Daniele Binosi und Lukas Theussl, um die Diagramme einfach in wissenschaftliche Arbeiten einbetten zu können. Das Latex-Satzsystem erfreut sich in den Naturwissenschaften und vor allem in der Physik seit vielen Jahren großer Beliebtheit, besonders wegen seiner Flexibilität und Effizienz. Bei Diagrammen kann es allerdings manchmal ohne Wysiwyg-Darstellung schwierig sein, das gewünschte Resultat zu erzielen, weshalb Jaxodraw den Bedürfnissen der Anwender sehr entgegenkommen dürfte.
Wie der Name bereits suggeriert, ist Jaxodraw in Java geschrieben. Damit ist das Programm auch weitgehend plattformunabhängig. Leider läuft es nur in der proprietären Java-Implementation von Sun einwandfrei. Mit IBMs Runtime Environment gibt es einige Probleme, wie auf[7] näher beschrieben wird. Jaxodraw selbst steht unter der GPL. Die Entwickler haben die Dokumentation von Jaxodraw als wissenschaftliche Arbeit auf[8] veröffentlicht und bitten alle Nutzer des Programms, in ihren Publikationen auf diese Seite zu verweisen, um dann besser abschätzen zu können, wie viele Leute Jaxodraw einsetzen.
Das ist eine sehr interessante Anknüpfung an die Ausführungen in der Brave GNU World (Ausgabe 11/03,[9]) bezüglich freier Software und deren Beziehung zur Wissenschaft, zeigt es doch praktisch, wie freie Software selbst wieder zu einer wissenschaftlichen Veröffentlichung wird.
Auch das nächste Projekt, gegenwärtig noch ein Geheimtipp, beschäftigt sich mit dem Setzen von Texten, richtet sich aber ausdrücklich nicht an Wissenschaftler. Die meisten GNU/Linux-Anwender kennen GNU Troff (Groff,[10]) wohl von den zahlreichen Manpages. Über den Aufruf »man Befehl« erhält der Benutzer formatierte Hilfeseiten zu den Kommandos eines Unix-artigen Systems. Wenigen ist allerdings bewusst, dass Groff ein vollwertiges Textsatzsystem wie Latex oder Lout ist, mit dem Anwender typografisch professionelle Postscript-Dokumente erzeugen.

Groff benötigt jedoch nur einen Bruchteil der Ressourcen von Latex, es läuft ohne größere Schwierigkeiten auch auf einem 386er mit 8 MByte RAM und 250 MByte Festplattenspeicher. Die Sparsamkeit bei den Ressourcen von GNU/Linux und Groff war es auch, die den kanadischen Schriftsteller Peter Schaffter dazu veranlasst hat, sich für diese Kombination zu entscheiden. Wie viele seiner Kollegen lebt er in wirtschaftlich nicht gerade glänzenden Verhältnissen. Er besitzt lediglich Computer, die er geschenkt bekommt und die daher bereits Generationen hinter der aktuellen Technik stehen - oder wie er es ausdrückt: "resource challenged".
Groff zeichnet sich nicht unbedingt durch einfache Benutzung aus, da die Kommandos zum größten Teil sehr knapp und nicht immer intuitiv sind. Aus diesem Grund begann Peter Schaffter mit der Arbeit an Mom[11]. Ähnlich wie Latex auf Tex aufsetzt, ist Mom ein Makroset für Groff, das eine einfache Syntax zur Verfügung stellt. Gleichzeitig erlaubt es eine sehr feine, anderen DTP-Lösungen ebenbürtige typografische Kontrolle über das erzeugte Dokument, ohne dabei Kenntnisse der kryptischen Groff-Syntax zu verlangen.
Moms Zielgruppe sind Setzer, die die Groff-Syntax bisher abgeschreckt hat, also zum Beispiel Autoren, die einfach und schnell ihre Texte setzen möchten, und Neueinsteiger, die Wert auf eine gut dokumentierte Lösung legen. Peter Schaffter hat sich nämlich besonders große Mühe mit der Dokumentation gegeben. Er ist davon überzeugt, dass gute Dokumentation eine wesentliche Komponente guter Programmentwicklung ist. Eine Aussage, die man nicht oft genug wiederholen kann. Die Dokumentation von Mom ist unter der Free Documentation License (FDL) im HTML-Format verfügbar.
Florian Cramer, der mich auf Mom aufmerksam machte, hebt vor allem drei Gründe hervor, die für den Einsatz von Mom sprechen:
Zu den Beschränkungen des Programms gehört, dass es sich - anders als Latex - nicht für den wissenschaftlichen Einsatz eignet, da es beispielsweise keine Kreuzreferenzen, Indizes oder nummerierten Abbildungen kennt. Außerdem ist die Anzahl der Ausgabeformate begrenzt. Mom ist auf die Ausgabe nach Postscript ausgelegt. Die Kommandos »grotty« und »grohtml« erlauben grundsätzlich auch reine Text- und HTML-Ausgaben, diese sind aber von Schaffter eigentlich nicht vorgesehen.
Ursprünglich von einem kanadischen Schriftsteller für den Eigenbedarf geschrieben, bietet Mom genau das, was viele Anwender brauchen: Ein einfaches und dennoch umfangreiches Angebot, Texte gut zu gestalten. Florian Cramer geht sogar noch weiter und stellt die Frage, warum die XML/SGML-Systeme alle nur Tex und nicht Groff für die Printausgabe verwenden. Denn seiner Meinung nach wäre Groff ein großartiges Ausgabeformat für XML-basierte Dokumente, wie O'Reilly ja bereits für die Kombination aus Docbook SGML und Groff mit dem Buch "Programming Perl" bewiesen hat. E
Für Florian Cramer ist Peter Schaffter einer der unbesungenen Helden freier Software, ihn hat besonders beeindruckt, wie offen und schnell Schaffter auf seinen Vorschlag (automatische Generierung eines Inhaltsverzeichnisses) reagierte. Wer Peter Schaffter kontaktieren möchte, sollte sicherstellen, dass die Worte "Groff" oder "Mom" im Betreff vorkommen, da sein Spamfilter alle anderen E-Mails aussortiert.
Auch wenn bei Bedarf noch ein paar kleinere Funktionen hinzukommen dürften, ist Mom mittlerweile als stabil eingestuft und Schaffter möchte den Benutzern die Entscheidung überlassen, welche Erweiterungen sinnvoll sind. Der Entschluss, auch Mom selbst wieder als freie Software unter der GPL herauszugeben, fiel sehr bewusst. Nicht nur als Dank an die Community, sondern auch, weil der Autor sich den gesellschaftlichen Hintergründen freier Software verbunden fühlt.
Es gibt zunehmend Versuche im klassischen Wissenschaftsbetrieb, sich dem Phänomen freie Software zu nähern. In verschiedenen Fachbereichen - von Wirtschaft bis Soziologie - finden sich mittlerweile Diplomarbeiten und Dissertationen zu diesem Thema. So auch die dänische Dissertation[12] zur Hacker-Ethik von Aputsiaq Niels Janussen. Obwohl Aputsiaq bereits freie Software und auch GNU/Linux kannte, hatte er sich bis zum Sommer 2002 nur wenig mit den Hintergründen auseinandergesetzt. Dann weckte unter anderem das GNU-Manifest[13] von Richard Stallman sein Interesse für die philosophischen Hintergründe des GNU-Projekts[2].
Basierend auf dem Buch "Hackers" von Stephen Levy aus dem Jahr 1984 begann er damit, sich ernsthaft mit dem Hacker-Phänomen zu beschäftigen, auch die konstruktive Auseinandersetzung mit "The Hacker Ethic" von Pekka Himanen ist Teil seiner Dissertation. Aputsiaq reichte seine Arbeit am 7. Juli 2003 ein. Sie ist also beendet und steht unter der Free Documentation License. Eine Übersetzung vom Dänischen ins Englische würde der Autor ausdrücklich begrüßen.
Als kleine Anekdote erwähnt Aputsiaq, dass bei seinen Diskussionen mit GNU-Vater Richard Stallman dieser von der Existenz einer Hacker-Ethik nicht besonders überzeugt war.
Über den Weltgipfel zur Informationsgesellschaft berichteten ja bereits mehrere Ausgaben der Brave GNU World (siehe[13]). Bei Redaktionsschluss war jedoch die Prepcom 3a beendet und der Gipfel stand unmittelbar bevor. Auch wenn Kanzler Schröder, der ursprünglich seine Teilnahme angekündigt hatte, wegen einer Sitzung des Vermittlungsausschusses die Teilnahme an Minister Clement delegieren musste, geht es hier doch um Fragen auf höchster Ebene. (Anmerkung der Redaktion: Auch Clement hatte letztlich wohl anderes zu tun und schickte Rezzo Schlauch.)
So blieben auch während der Prepcom 3a die Fragen nach Menschenrechten, Finanzierung, begrenzten geistigen Monopolen (speziell Copyright und Patente, siehe auch[14]) und freier Software offen. Bei freier Software zeichnete sich ein Kompromiss ab, jedoch machten die USA ihre Zustimmung abhängig von der Akzeptanz des Paragrafen zu begrenzten geistigen Monopolen.
Die Gruppe zu diesem Thema traf sich mehrere Abende hintereinander um 19:00 "open ended" zu Gesprächen und vertagte sich üblicherweise gegen 22:30 ergebnislos. Während dieser 3,5 Stunden geschlossener Verhandlungen nach einem langen, ermüdenden Konferenztag ohne ausreichende Versorgung mit Nahrung oder Frischluft zeigte sich wenig Kompromissbereitschaft.
Den zweiten Abend leitete die Motion Picture Association of America (MPAA) mit einem Statement ein, bevor sie, wie auch die Vertreterin der World Intellectual Property Organization (WIPO), den Raum verlassen musste. Das deutsche Justizministerium flog eigens einen Fachmann für den Themenbereich der begrenzten geistigen Monopole zur Konsultation ein.
Nach letzten Informationen drehten sich die folgenden Verhandlungen auf der Prepcom weiter um diesen Punkt. Den Vorschlag der Zivilgesellschaften, der diese Quadratur des Kreises tatsächlich zu leisten verspricht, wollte niemand offiziell einbringen, da man fürchtete, durch das Einbringen neuer Texte eher einen Rückschritt zu riskieren.
Interessant könnte in diesem Zusammenhang noch der Artikel "Fighting Intellectual Poverty - Who owns and controls the information societies?"[15] sein, der für eine Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung anlässlich des Gipfels entstanden ist. Die Zivilgesellschaften, also jene Gipfelteilnehmer, die weder Regierung noch Wirtschaft oder UNO-nahe Organisationen repräsentieren, haben sich jetzt zunehmend darauf konzentriert, die eigenen Prozesse voranzubringen. So wurde während der Prepcom 3a das Dokument verfeinert, das ursprünglich als "nicht verhandelbare Punkte" (non negotiables) entstand.
Auf vier Seiten beschreiben diese "Essenziellen Maßstäben der Zivilgesellschaft" (Civil Society Essential Benchmarks,[16]) die zentralen Punkte und stellen die aus zivilgesellschaftlicher Sicht wegweisenden Entscheidungen dar. So kompakt und umfassend war bisher kein Dokument - auch die zivilgesellschaftliche "Visionäre Deklaration", die zurzeit als Gegenentwurf zur Deklaration des Regierungsgipfels entsteht, wird sich daran messen müssen.
Doch auch innerhalb der Zivilgesellschaften besteht weiterhin großer Diskussionsbedarf und die Unterschiede beziehen sich dabei auf die verschiedensten Gebiete. So ist beim Thema der Internet Governance noch immer eine Diskrepanz zwischen Norden und Süden zu verzeichnen. Der Norden ist um Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle bemüht, während der Süden von staatlicher Kontrolle eine wünschenswerte Stabilität erwartet.
Auch bei den Fragen der begrenzten geistigen Monopole herrscht noch Diskussionsbedarf. Während einige Organisationen, die sich für die Rechte der Ureinwohner einsetzen, den Schutz ihres kulturellen Erbes durch Ausweitung von Monopolrechten erreichen wollen, steht dies in Konflikt zu großen Teilen des Planeten, die sich durch eine Neuausrichtung der Monopole endlich Zugriff auf Wissen und damit eine Überwindung der digitalen Spaltung erhoffen.
Und selbst bei grundsätzlich eher unstrittigen Fragen innerhalb der Zivilgesellschaften herrscht weiterhin Diskussionsbedarf zwischen Süd und Nord, Frau und Mann, Jung und Alt und den verschiedenen Disziplinen. Denn es gibt auch innerhalb der Zivilgesellschaften viele, die beispielsweise noch nicht verstanden haben, warum Software eine neue Kulturtechnik ist und warum freie Software die Antwort auf wichtige gesellschaftliche Fragen gibt.
Meine persönliche Lieblingsaussage zu diesem Thema stammt aus der Prepcom-3a-Arbeitsgruppe zum "Freie-Software-Paragrafen": Dort bestätigte eine Vertreterin der US-Regierungsdelegation, dass es sich bei der Wahl zwischen proprietärer und freier Software um eine politische und keine technische Entscheidung handle, doch der Gipfel sei nicht das richtige Gremium, um politische Entscheidungen zu treffen.
Als letztes Thema in dieser Ausgabe soll noch eine Absurdität angesprochen werden, die in letzter Zeit massiv um sich greift: drahtlose Internetzugänge für lächerlich hohe Gebühren. Die Hotel-Lobby oder die Lounge eines Flughafens mit drahtlosem Internetzugang ausrüsten ist in Europa heute mit einer einmaligen Investition von maximal 500 Euro und monatlichen Kosten um die 30 Euro für eine DSL Flatrate verbunden.

Die Preise für den drahtlosen Zugang liegen jedoch üblicherweise bei drei bis zehn Euro pro halber Stunde. Außerdem ist es oft nur möglich, mit Prepaid-Karten zu bezahlen, die den Betreibern aber gerne mal ausgehen. Hat man die richtige Karte aufgetrieben, ist das auch noch immer nicht das Ende der Probleme, da die Anbieter erfahrungsgemäß nicht in der Lage sind, stabile Webseiten zu entwerfen, die mit allen Browsern funktionieren.
Bedenkt man die verschwindend geringen Kosten für Einrichtung und Betrieb eines drahtlosen Internetzugangs, beispielsweise im Vergleich zur Installation von Wasser- und Sanitäranlagen, sollten Anwender also erwarten, demnächst in Hotels an der Toilettenspülung, der Dusche und am Wasserhahn einen Münzschlitz vorzufinden. Allerdings leben wir ja bereits seit einiger Zeit im Sanitärzeitalter, das Informationszeitalter scheint angesichts solcher Entwicklungen noch sehr weit entfernt zu sein.
Damit genug der Brave GNU World für diese Ausgabe. Ich wünsche allen Lesern ein gutes Jahr 2004 und hoffe, Ihr werdet nicht mit Anregungen, Kommentaren und Projektvorschlägen an die übliche Adresse[1] sparen. (mwe)
| Der Autor |
|
Dipl.-Phys. Georg C. F. Greve beschäftigt sich seit etlichen Jahren mit freier Software und kam früh zu GNU/Linux. Nach Mitarbeit im GNU-Projekt und seiner Aktivität als dessen europäischer Sprecher hat er die Free Software Foundation Europe initiiert, deren Präsident er ist. Mehr Informationen finden sich unter: [http://www.gnuhh.org]

|